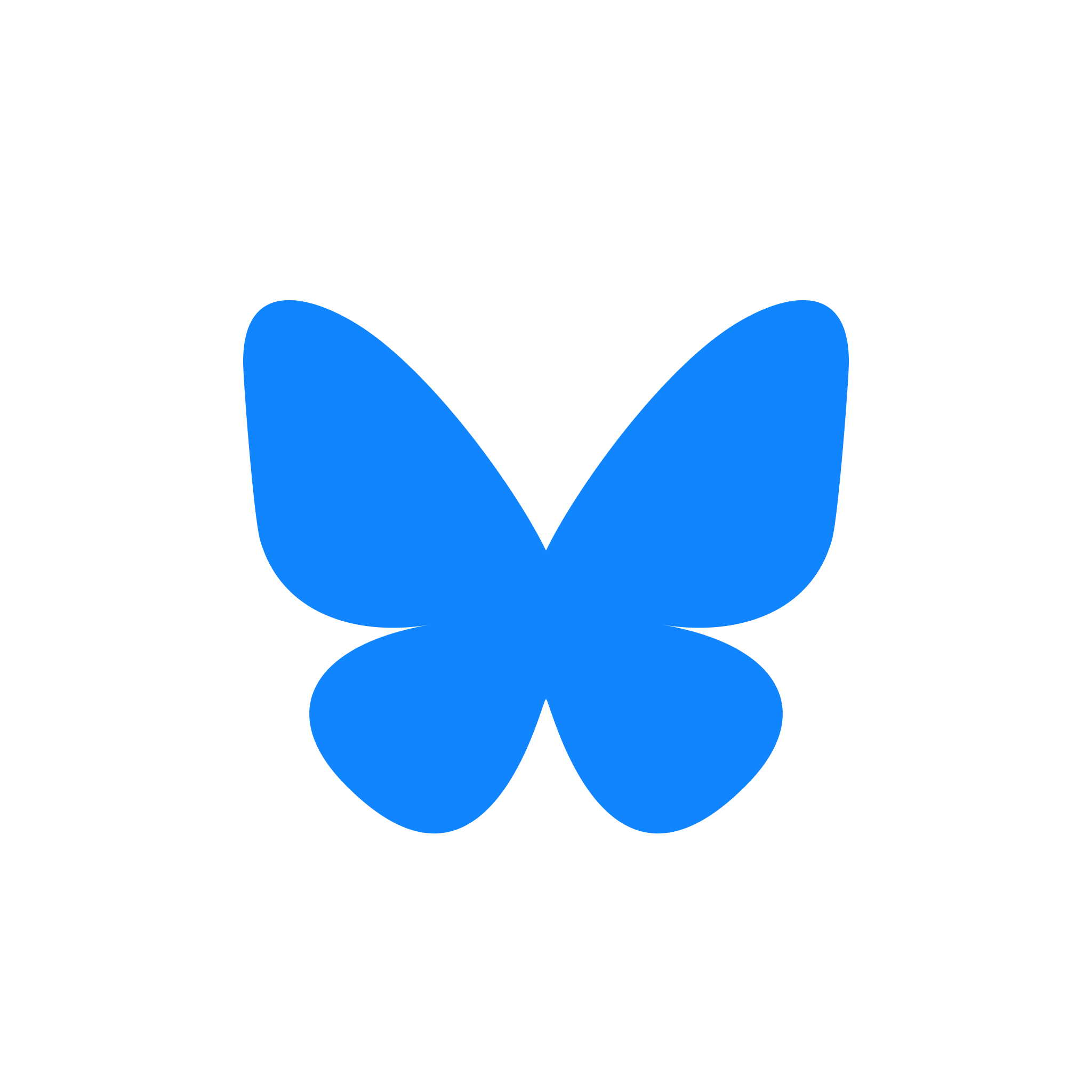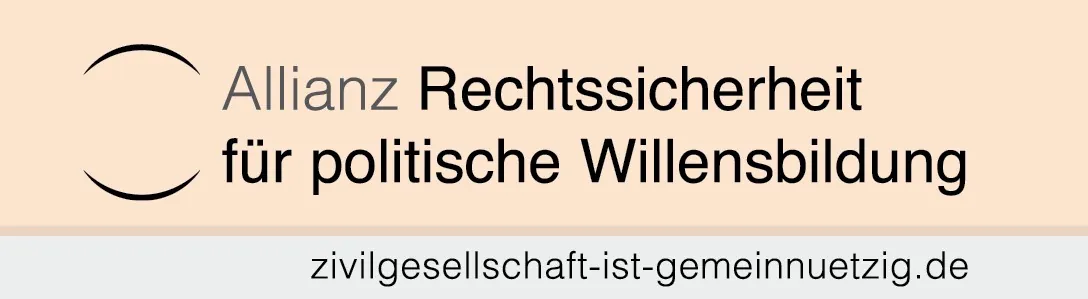In der Wirtschaftswoche vom 11. Juli 2016 ist ein großer Artikel zu Gemeinnützigkeit erschienen, der jedoch verschiedene Aspekte vermengt. Letztlich geht es in dem Artikel darum, dass sich eigennützige und wirtschaftliche Interessen gelegentlich in der Gemeinnützigkeit verstecken. Nur ungenau unterschieden wird dabei der Fall, dass sich Menschen oder Unternehmen zum eigenen Nutzen zusammentun und dabei Vorteile der Gemeinnützigkeit nutzen, von dem Vorwurf gegen gemeinnützige Organisationen, sie wären im Wettbewerb gegenüber Profit-Unternehmen im Vorteil.
Kategorie: Presse
Das Magazin „Der Spiegel“ berichtet in seiner Ausgabe vom 30. April 2016 über mehrere gemeinnützige Vereine, die von der rechtspopulistischen Politikerin Beatrix von Storch betrieben werden. Insbesondere geht es um den Verein „Zivile Koalition“. Der Spiegel kritisiert in dem Bericht unter anderem den lässigen Umgang mit Buchhaltung und Vermögen der Vereine, dass Verwendungszwecke von Spenden unklar sind und dass mit systematischem Fundraising Politaktivismus finanziert werde. Zudem stellt er die Selbstlosigkeit der Vereine in Frage, da mit ihnen durch Mietzahlungen Immobilien der Storch-Familie finanziert werden.
Dass Vereine Spenden sammeln, um damit ihre gemeinnützigen Zwecke auch mit politischen Mitteln zu finanzieren, dass sie dazu auch Fachpersonal beschäftigen und professionell auftreten, sollte in einer Demokratie selbstverständlich möglich sein. Was der Spiegel beschreibt, stellt allerdings die Gemeinnützigkeit der Vereine aus anderen Gründen in Frage.
Allianz fordert Gesetzesänderung: Gemeinnützigkeitsrecht muss Attac und anderen aktiven Vereinen Sicherheit geben
Das Finanzamt Frankfurt verweigert dem globalisierungskritischen Netzwerk Attac weiterhin die Gemeinnützigkeit. Wie Attac jetzt mitteilte, hat das Finanzamt den Einspruch des Trägervereins gegen den aberkennenden Bescheid abgelehnt.
„Bund und Länder müssen das Gemeinnützigkeitsrecht sofort ändern. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die zu einer starken Demokratie beitragen, dürfen nicht länger Gefahr laufen, ihre Gemeinnützigkeit zu verlieren. Es gibt einen gesellschaftlichen und politischen Konsens, dass zivilgesellschaftliches Engagement auch politisch sein darf. Das Gesetz bildet diesen Konsens nicht ab, es ist unklar und widersprüchlich“, erklärt dazu Stefan Diefenbach-Trommer, Koordinator der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“.
Wir beschäftigen uns mit Gemeinnützigkeit. Das ist ein Thema für Finanzämter und Steuerrechtlerinnen – scheinbar. Doch es geht um viel mehr. Es geht darum, wie diese Gesellschaft, wie Demokratie funktioniert. Wer auf Entscheidungen Einfluss nimmt. Wie sich Bürgerinnen und Bürger organisieren können. Es geht auch darum, wie die Macht finanzstarker Akteure in der politischen Willensbildung in ein Gleichgewicht mit selbstlosen Akteuren, die zum Wohle der Allgemeinheit handeln, gebracht werden können.
Diese Ebene hat sehr fundiert und engagiert Andreas Zielcke in der Süddeutschen Zeitung untersucht. Unter der Überschrift „Aktivismus unerwünscht“ kritisiert der Journalist in der Ausgabe vom 15. Februar 2016, dass im Gemeinnützigkeitsrecht ein Staatsverständnis vorherrsche, dass den Wandel des Gemeinwesens hin zu mehr Demokratie verkenne. In diesem Verständnis würden nur Parteien als politische Gruppierungen subventioniert. „Doch je weiter Demokratisierung voranschreitet, desto mehr verschiebt sich auch die Definitionsherrschaft darüber, was unter Gemeinwohl zu verstehen ist, vom Staat und politischem Establishment auf die, die es angeht“, schreibt Zielcke, und kommt zum Schluss: „Die Devise ‚alles Gemeinwohl ist politisch‘ versteht sich, müsste man denken, mehr denn je von selbst.“
Die Debatte über Gemeinnützigkeit und politische Willensbildung nimmt im neuen Jahr Fahrt auf. Zwei große Medien der NGO-Branche nehmen sich des Problems an
„Lebe lieber unpolitisch“ überschreibt die Zeitschrift „Die Stiftung“ ihre Titelgeschichte der Januar-Ausgabe über die Schwierigkeiten gemeinnütziger Organisationen mit gesellschaftlicher Einmischung. Die Situation und die Forderungen der Allianz werden fundiert und gut lesbar aufbereitet. Die Zeitschrift konstatiert eine „rechtliche Grauzone“, wenn sich zivilgesellschaftliche Organisationen in politische Entscheidungsprozesse einmischen. Herausgeber Gregor Jungheim schreibt im Editorial, dass die verschiedenen Folgen von Einmischung „einen schalen Beigeschmack“ hinterlassen.
Bereits um den Jahreswechsel 2015/2016 berichteten mehrere Medien über Campact und die Forderung eines CDU-Bundestagsabgeordneten. Der hatte verlangt, die Gemeinnützigkeit von Campact zu prüfen, da der Verein Politik betreibe Der CDU-Politiker verwendete dafür bereits im Laufe des Jahres 2015 den Begriff „Empörungsindustrie“. Damit zielte er auf gemeinnützige zivilgesellschaftliche Organisationen, die gegen das geplante Freihandelsabkommen TTIP Stellung bezogen hatten.
Der Begriff „Empörungsindustrie“ ist perfide, denn er stellt eine der Säulen der Gemeinnützigkeit in Frage. Gemeinnützig ist, wer selbstlos das Wohl der Allgemeinheit fördert – das ist ein entscheidender Unterschied zu Industrie-Lobbyisten, die im Interesse ihrer Auftraggeber oder der eigenen Firma handeln. Genau dies ist bei gemeinnützigen Organisationen nicht der Fall.
Das Finanzamt Frankfurt hat der Prostituiertenberatungsstelle Doña Carmen rückwirkend ab 2011 die Gemeinnützigkeit aberkannt und verlangt, dass der Verein sein Vermögen abführt. Dazu erklärt Stefan Diefenbach-Trommer, Koordinator der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“:
„Bund und Länder müssen das Gemeinnützigkeitsrecht ändern. Zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich selbstlos für die Allgemeinheit engagieren, können künftige Entscheidungen des Finanzamtes kaum vorhersagen und sind daher von Rechtsunsicherheit bedroht. Das Gesetz bildet heute nicht den gesellschaftlichen Konsens darüber ab, was gemeinnützig ist.
Auf einer Doppelseite nimmt sich die Frankfurter Rundschau in der Wochenendausgabe dem Thema Gemeinnützigkeit und politische Willensbildung an. Auf den Seiten 2 und 3 berichtet Attac-Geschäftsführerin Stephanie Handtmann im Interview von der laufenden Auseinandersetzung: „Wir sind seit Mai 2014 im Widerspruchsverfahren und erwarten im Herbst eine Entscheidung. Wir als Attac sind hundertprozentig davon überzeugt, dass wir gemeinnützig sind, und wir werden vor Gericht gehen, falls wir einen negativen Bescheid erhalten.“ Attac gehöre selbstverständlich zu den Organisationen, die sich für das Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Sie berichtet auch davon, wie sehr es die Arbeit erschwert, wenn der steuerrechtliche Gemeinnützigkeits-Status fehlt. Die Gründung der Allianz „Rechtssicherheit für politische Willensbildung“ wird ebenfalls berichtet.
Am aktuellen Beispiel des Engagements für Flüchtende analysiert die Frankfurter Rundschau: „Wenn die Helfer Flüchtlingen Deutsch beibringen, alte Spielsachen und Kleidungsstücke aus dem Keller holen und sie in ihren Privatwohnungen unterbringen, übernehmen sie jedoch Aufgaben, die eigentlich organisatorische Angelegenheit des Staates wären. … Das Engagement der Bürger wird automatisch politisch, da sie öffentliche Aufgaben übernehmen.“
Stefan Nährlich, Geschäftsführer des Vereins Aktive Bürgerschaft, kommt mit der Forderung zu Wort, dass der Staat den gemeinnützigen Verbänden erlauben müsse, an der politischen Willensbildung mitzuwirken.
Die „Stuttgarter Nachrichten“ beleuchten mit der „Stiftung Familienunternehmen“ einen weiteren Fall, in dem sich ein Lobbyverband der Gemeinnützigkeit bedient. Diese Stiftung nimmt ganz offenbar Einfluss auf die politische Willensbildung, wenn sie gegen die Erbschaftssteuer kämpft – doch tut sie das nicht selbstlos und nicht im Interesse der Allgemeinheit, sondern für ganz spezifische Interessen, für einen sehr begrenzten Kreis von Begünstigten.
Soll es gemeinnützig sein, sich in politische Debatten einzumischen? In einer streitbaren Demokratie kann die Antwort nur „Ja!“ lauten. Doch unter welcher Bedingung sollte diese Einmischung steuerlich begünstigt sein? Sie muss selbstlos die Allgemeinheit fördern.
Die „Stuttgarter Nachrichten“ steigen prominent auf Seite 1 ein, liefern auf einer halben Zeitungsseite mehr Hintergrund und kommentieren schließlich: „Das Finanzamt streicht Attac die Gemeinnützigkeit, weil die linke Lobbytruppe eine Steuer auf Finanztransaktionen fordert.Und eine „Stiftung“, die die Abschaffung einer Steuer fordert – der Erbschaftsteuer – bleibt unbehelligt? Man muss kein Experte sein, um zu merken: Da passt etwas nicht zusammen.“
Als gemeinnützig anerkannt sein können nur Organisationen, die selbstlos die Allgemeinheit fördern. Die ARD-Reportage „Steuerfrei e. V. – Millionengeschäfte mit der Gemeinnützigkeit“ zeigte am 24. August 2015 Organisationen, die offenbar nicht selbstlos handeln, sondern nur im Interesse ihrer Mitglieder – und die dennoch als gemeinnützig anerkannt sind.
Unverständlich ist, dass anderen Organisationen die Gemeinnützigkeit entzogen wird, wenn sie selbstlos zur Förderung der Allgemeinheit an der politischen Willensbildung mitwirken. Die „Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik“ lobbyiiert für Waffenhersteller und ist als gemeinnützig anerkannt. Wenn Vereine wie Attac eine gerechte Steuerpolitik fordern, streicht das Finanzamt die Gemeinnützigkeit.
Die Reportage kritisiert etwas zu allgemein Schlupflöcher in der Gemeinnützigkeit, ohne den Unterschied zwischen Selbstlosigkeit und Förderung der Allgemeinheit deutlich zu machen. Sie zitiert mit Prof. Dr. Wolfram Richter eine Haltung, das Gemeinnützigkeitsrecht generell deutlich restriktiver zu handhaben, womit auch gesellschaftliches Engagement anders behandelt würde.
LobbyControl weist in einem Blog-Beitrag auf zwei weitere Beispiele hin, bei denen kommerzielle Interessen von Unternehmen mit den Aktivitäten an sie gebundener gemeinnütziger Organisationen vermischt werden.